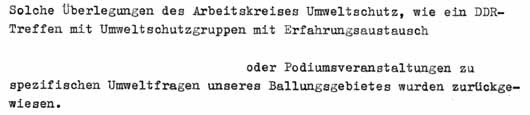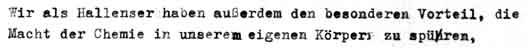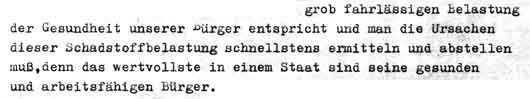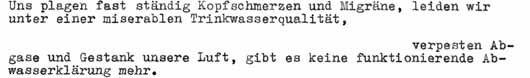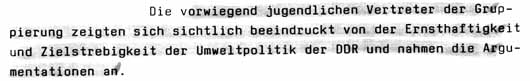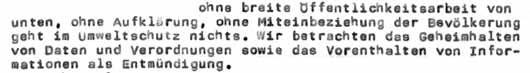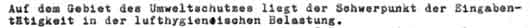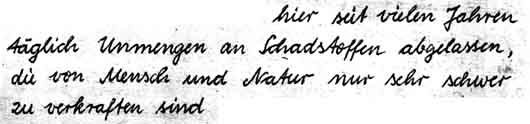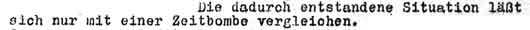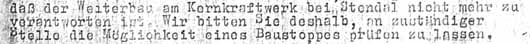(Umwelt-)Bewegung
Der Protest gegen die verheerende Umweltsituation in der DDR reichte von individuellen Eingaben bis zur politischen Opposition. Die Reaktorkatastrophe in Tschernobyl zog 1986 eine zunehmende Vernetzung der Umweltbewegung in der DDR nach sich – die Gründung einer Umweltbibliothek in Berlin stärkte den Informationsaustausch.
Die SED hatte seit 1980 als institutionellen Rahmen für Umweltschützer eine Gesellschaft für Natur und Umwelt beim Kulturbund aufgebaut, die 1989 in Halle anlässlich des Weltumwelttages in Abgrenzung von der oppositionellen Umweltbewegung ein „ausgewogenes, breit gefächertes, viele Interesse und Tätigkeiten umfassendes Programm“ realisieren und eine „sozialistische Umweltpolitik“ propagieren sollte.
Die „Schluderei“ sei nicht länger zu ertragen und „für diesen Staat äußerst blamabel“; die „Offenlegung aller wahren Umweltwerte“ stünde ebenso an wie die Durchsetzung des Verursacherprinzips und „breite Aufklärungskampagnen in der Bevölkerung“.
die Umweltbewegten fühlten sich längst „frustriert durch die Antworten und die Versuche uns zu entmündigen“. Die Opposition verlangte „eine freie umfassende Information, Offenheit und breite Kontrollmöglichkeiten“.
Und trotz aller Beschwichtigungen („Unsere Kernkraftwerke sind sicherheitstechnisch so konstruiert, projektiert und gebaut, dass auch bei dem größten anzunehmenden Unfall Auswirkungen auf die Umwelt durch Sicherheitseinrichtungen verhindert werden.“) blieb seit 1986 die Forderung virulent, auf den Bau eines Atomkraftwerkes im Bezirk Magdeburg zu verzichten.